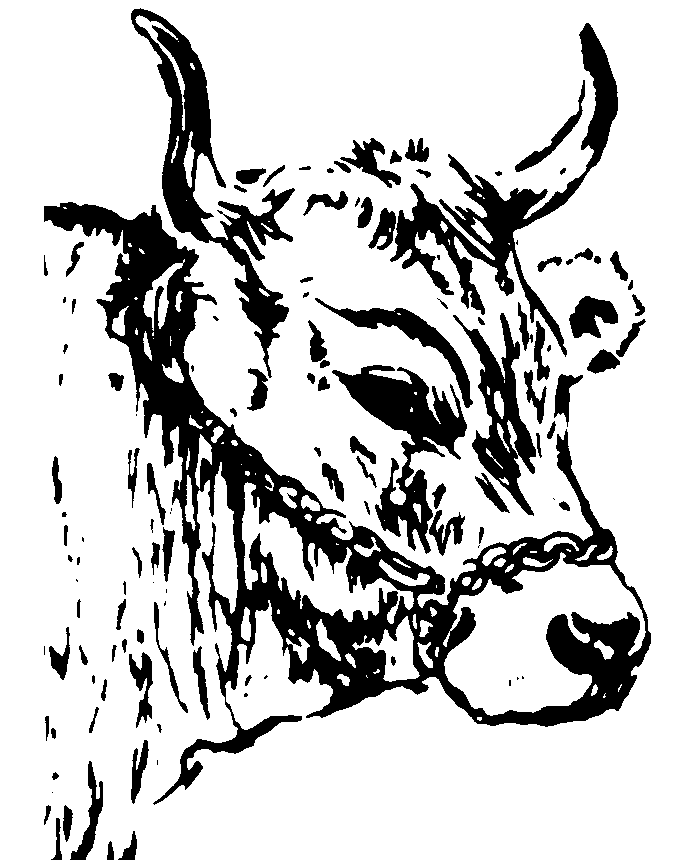Das Dual Breeding Projekt Phase 2
Zweinutzungsrinder :
Wie man umwelt- und tierfreundlich produziert – DBP2
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist seit langem eine Priorität der europäischen Agrarpolitik und spielt eine zentrale Rolle bei den Aktivitäten, die alle Länder bei der Programmierung ihrer Pläne für die ländliche Entwicklung durchführen. Laut dem jüngsten Bericht über den Zustand der weltweiten tiergenetischen Ressourcen (FAO, 2019) sind mehr als 26% der Haustierarten vom Aussterben bedroht, eine Zahl, die sich im Laufe der Jahre deutlich verschlechtert hat. In Italien gilt eine beträchtliche Anzahl von Rassen als autochthon, da sie nur auf italienischem Gebiet entstanden sind und dort ihre Eigenheiten entwickelt haben.
Das DBP2-Projekt umfasst wie das vorherige Projekt alle 16 in Anhang 4 der Aufforderung genannten Zweinutzungsrassen, von denen 14 als gefährdet gelten, und ist auf die Verfolgung der in Untermaßnahme 10.2 genannten Ziele ausgerichtet. Die Komplexität des Projekts ergibt sich auch aus der Tatsache, dass wir es mit Rassen zu tun haben, die sehr unterschiedliche Selektionsgeschichten, Konsistenzen und Produktionseigenschaften haben und in sehr unterschiedlichen ökologischen und wirtschaftlich-produktiven Kontexten gezüchtet werden.
Die einzelnen Projekte weisen spezifische Elemente auf, die sie charakterisieren und von den anderen unterscheiden, unbeschadet der Ziele, die durch die Untermaßnahme 10.2 vorgegeben werden.
Dieses zweite Projekt sollte nicht nur als Fortsetzung dessen gesehen werden, was bereits in DBP Phase 1 entwickelt wurde, denn es gibt viele neue Elemente, die es charakterisieren und von seinem Vorgänger unterscheiden. Einige Aktivitäten bleiben gegenüber dem vorherigen Projekt weitgehend unverändert, da mehr Informationen integriert werden sollen, insbesondere in Bezug auf phänotypische und genetische Charakterisierungsmaßnahmen. Zweitens ist im Falle der geschätzten genetischen Parameter für neu entdeckte Merkmale geplant, die während der DBP-Phase 1 durchgeführten Studien zu wiederholen, um die neu verfügbaren Informationen (sowohl Phänotypen als auch Genotypen) zu integrieren und robustere Schätzungen zu erhalten.
Die Auswirkungen auf die Umwelt, das Wohlergehen der Tiere und die biologische Vielfalt sind eng miteinander verknüpft, denn Tiere mit geringer Inzucht, die resistent gegen Krankheiten und langlebig sind, sind der erste Schritt zur Reduzierung der Umweltbelastung. Die Beibehaltung von Selektionsrichtlinien, wo dies vorgesehen ist, mit der doppelten Eignung als Endziel ist an sich ein nützliches Instrument, in erster Linie für die Erhaltung der genetischen Variabilität einer Population, da die Selektion auf Milch und Fleisch dazu führt, dass angesichts der ungünstigen genetischen Korrelation zwischen den beiden Eignungen unterschiedliche Blutlinien hervorgehoben und ausgewählt werden. Zweitens kann dies dazu beitragen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen, da es Untersuchungen gibt, die darauf hinweisen, dass aufgrund der Doppelhaltung für die gleiche Menge an produzierter Milch und Fleisch weniger Tiere benötigt werden (Zehetmeier et all.; 2012), auch im Hinblick auf den geringeren Ersatzbedarf. Die gleiche Verbesserung der Langlebigkeit, auch durch die Identifizierung und Untersuchung von Merkmalen im Zusammenhang mit der Krankheitsresistenz, führt zu geringeren Anforderungen an die Aufzucht und folglich zu einer geringeren Umweltbelastung. Letzteres wird nämlich nicht nur durch den Ausstoß von Methan, Kohlendioxid und stickstoffhaltigen Rückständen bestimmt, sondern auch durch den geringeren Einsatz von Medikamenten (insbesondere Antibiotika), was zu einer geringeren Umweltverschmutzung bei der Herstellung, Verwendung und Entsorgung von Medikamenten führt.
Der erste Punkt, den es zu verfolgen gilt, ist die Bewertung und Schaffung und Nutzung der notwendigen Instrumente, um die Inzucht zu kontrollieren und die Variabilität der Rassen des Zweinutzungssektors zu erhalten, von denen einige ernsthaft von Problemen der genetischen Drift betroffen sind.
Die Erfassung neuer Phänotypen, die sich aus der Untermaßnahme 16.2 und aus Erhebungen an Kontrollstrukturen ergeben, die phänotypische und genetische Charakterisierung, die Studie zur Erstellung neuer genetischer Indizes (für Indikatormerkmale der Umweltbelastung, der Tiergesundheit), die Überwachung der Inzucht mit neuen und effizienten Methoden, die Nutzung von Anwendungen für das Management der Paarung von Populationen sind die Aktionen, die zur Verfolgung der in der Untermaßnahme 10.2 genannten Ziele durchgeführt werden sollen.
Die Auswirkungen auf den genetischen Fortschritt, die sich aus der Einführung neuer Merkmale in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit und die Tiergesundheit ergeben, werden abgeschätzt. Die Verbesserung der Produktionseffizienz, die mit Hilfe der Genetik erreicht werden kann, bedeutet auch einen Vorteil für die Umwelt. Um den Nutzen für die Umwelt zu bewerten, wird für alle in DBP2 enthaltenen Rassen eine Ökobilanz durchgeführt, ein Verfahren, das darauf abzielt, den Beitrag der genetischen Verbesserung zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu bestimmen (Molina et al., 2015). Für jedes Verbesserungsziel werden die ökologischen und ökonomischen Kosten des Fortschritts und der ökologische und ökonomische Nutzen in Bezug auf die Umwelt quantifiziert.
Die begleitende Aktivität, die darauf abzielt, Landwirte und Techniker, die in diesem Sektor arbeiten, zu schulen und für die Themen und Probleme zu sensibilisieren, die für die Untermaßnahme 10.2 von Interesse sind, ist von grundlegender Bedeutung. Diese Aktivität richtet sich auch an die breite Öffentlichkeit mit dem Ziel, sie auf die Existenz dieser Tiere aufmerksam zu machen, auch um die Produkte aus ihrer Zucht aufzuwerten. Nur dank einer angemessenen Entlohnung der Züchter, die in ihren Beständen begrenzte und schlecht ausgewählte Rassen haben, werden sie weiterhin diese Art von Tieren züchten und die biologische Vielfalt erhalten, wodurch die Teilmaßnahme in der Praxis auf dem gesamten Gebiet wirksam wird.
Die beteiligten nationalen Verbände
Die nationalen Verbände der Rassen Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI), Grigio Alpina (ANAGA), Rendena (ANARE), Reggiana (ANABORARE) und Valdostana (ANABORAVA) haben sich zu einem gemeinsamen Projekt namens ‚DUAL BREEDING‘ zusammengeschlossen. Das Projekt umfasst insgesamt 16 Zweinutzungsrassen von Val d’Aosta bis Sizilien und wird vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Verwaltungsbehörde: MiPAAF) im Rahmen des Nationalen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums – Untermaßnahme 10.2 – finanziert.
Referenzstandards:
Ministerieller Erlass vom 23/02/2018 Nr. 7366, um den Zuschuss für das Projekt DUAL BREEDING Untermaßnahme 10 zu gewähren.
Europäischer Rechtshinweis: Verordnung (EU) 1305/2013. über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (FEASR).
Ministerieller Erlass vom 08/04/2021 Nr. 161044 zur Gewährung des Zuschusses für das Projekt DUAL BREEDING Phase 2 DBP2 Untermaßnahme 10.2.